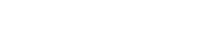Literatur und Texte
Manche Bilder wollen nicht betrachtet werden.
Sie wollen begegnet werden.
Ich sehe dich ist eine Einladung, Fotografie nicht als Ergebnis zu verstehen,
sondern als Weg.
Als achtsame Gestaltung.
Als stillen Dialog zwischen Blick, Bild und dem, was in uns mitschwingt.
Wer sich für die Neue Emotionale Sachlichkeit interessiert
und Fotografie als Mittel der Selbstwahrnehmung begreifen möchte,
findet in diesem Buch Raum zum Verweilen, Denken und Sehenlernen.
Erhältlich bei der Buchhandlung Ihres Vertrauens
oder direkt über diesen Link.
Innehalten Fotografieren
zur Buchbestellung
Eine Kamera fürs Leben.
In einer Welt, die immer schneller wird, in der wir ständig erreichbar sind und das Smartphone zum Dauerbegleiter geworden ist,
wann nehmen wir uns noch Zeit, wirklich hinzusehen?
Nicht nur nach außen. Sondern nach innen.
Was wäre, wenn wir die Kamera – sei es die große Spiegelreflex oder einfach nur unser Smartphone – nicht nur nutzen, um Erinnerungen festzuhalten, sondern um uns selbst zu begegnen?
Fotografie kann mehr sein als ein schönes Bild.
Sie kann ein Werkzeug der Achtsamkeit sein, ein Spiegel für unsere Gedanken, Emotionen und Lebensziele.
Mit jeder bewussten Aufnahme treffen wir eine Entscheidung:
Was sehe ich und was fühle ich dabei?
Welches Motiv spricht mich an und warum?
Was in der äußeren Welt berührt mein Innerstes?
Wenn wir beginnen, unser Smartphone nicht nur als Ablenkung zu nutzen, sondern als Einladung zur Selbstreflexion, verändert sich unser Blick, auf das, was echt ist; Was bleibt; Was uns ausmacht.
Nutze deine Kamera nicht nur für Selfies oder Schnappschüsse.
Nutze sie um zu Verstehen.
Nicht für Likes.
Sondern für das Leben.
Meine Kunst ist unverkäuflich
Kunst kann man nicht kaufen …
Natürlich kann man meine Fotografien erwerben.
Limitierte, handsignierte Exponate.
Sorgfältig produziert, gerahmt, bereit für Sammlungen und Ausstellungen.
Aber was man kauft, ist ein Werk. Kein Kunstwerk.
Denn Kunst kann man nicht kaufen.
Kunst wird erlebt.
Was man sieht, sehen alle gleich.
Aber was man empfindet das empfindet jeder anders.
Geprägt von der eigenen Vergangenheit, der Erziehung, den Erlebnissen.
Geführt von unseren Wünschen, Visionen, Begeisterungen.
Ein und dasselbe Bild und doch unzählige Wahrnehmungen.
Und genau das macht Kunst lebendig.
Kunst ist keine Ware. Kunst ist ein Resonanzraum.
Ein Möglichkeitsraum für das, was im Betrachtenden schwingt.
Doch das Kunstwerk selbst entsteht im Unsichtbaren.
Zwischen dem Werk und dem Betrachtenden.
Im Raum dazwischen.
Und dieser Raum ist unverkäuflich.
Darum ist Kunst immer auch Freiheit.
Freiheit des Sehens. Freiheit des Deutens. Freiheit des Fühlens.
Habe Mut
Viele Menschen machen Kunst.
Sie malen, schreiben, singen, gestalten, spielen Theater, entwerfen, bauen, fotografieren.
Doch ihre Werke sehen wir selten in Museen, Galerien oder auf Bühnen.
Sie erscheinen nicht in Fachzeitschriften, nicht im Feuilleton, nicht in Förderkatalogen.
Die „große Öffentlichkeit“ bleibt ihnen verwehrt.
Was einige Wenige – die als professionell gelten – schaffen, wird gezeigt, bewertet und erhält Reichweite.
Was Millionen andere in Ateliers, Wohnzimmern, Notizbüchern oder Kellerräumen erschaffen, bleibt unsichtbar.
Verborgen der gesellschaftlichen Wahrnehmung, entzogen jeder kritischen Auseinandersetzung.
Dabei liegt dort – im Verborgenen – das eigentlich Relevante:
das Massenerleben, das individuelle Entdecken, das nicht normierte Ausdrucksbedürfnis.
Eine echte Weltausstellung der Kunst müsste all das zeigen,
was in Mappen, Kisten, Dateien und Gedanken versteckt liegt.
Nicht nur das Kuratierte, sondern das Menschliche.
Die Trennung zwischen „Professionellen“ und „Laien“ in der Kunst ist dabei nur ein Spiegel unserer gesamten Gesellschaft.
Der professionelle Künstler ist, im tiefsten Sinn, ein Systembewahrer.
Der Amateur dagegen wirkt wie eine stille Bedrohung:
nicht kontrollierbar, nicht kalkulierbar, nicht verfügbar.
Deshalb wird er durch Konsumangebote, durch Kurse, durch Plattformen kanalisiert und neutralisiert.
Der Blick des professionellen Kunstbetriebs auf die Wirklichkeit ähnelt dem der Nutte auf den Kunden:
Er sucht nach Verwertbarkeit.
Nach Anschlussfähigkeit.
Nach Aufmerksamkeit.
Der Profi ist immer zu Diensten, aber nicht jedem.
Sondern dem Teil der Gesellschaft, der entscheidet, was „wertvoll“ ist.
Wo das Geld sitzt. Wo die Anerkennung wartet.
Der Amateur dagegen liebt, was er tut.
Und genau das ist der Unterschied.
Diese Liebe zur eigenen Arbeit hat Konsequenzen,
denn unsere Gesellschaft honoriert nicht, was wir lieben,
sondern das, was wir für ihren Fortbestand leisten.
Habe den Mut du selbst zu sein.
Vom Plüsch der Erziehung und Filz der Prägung
Du warst mal frei.
Frei geboren.
Bevor du wusstest, wie man sich benehmen muss.
Bevor man dir sagte, was „man halt so macht“.
Bevor du gelernt hast, dass Sicherheit mehr zählt als Wahrheit.
Dann kam das Leben.
Mit dem Plüsch der Erziehung deiner Eltern.
Mit ihrem Wunsch nach deiner Perfektion.
Mit ihren Normen, ihren Erwartungen, ihrer Etikette.
Und du hast dich eingefügt:
Leise. Korrekt. Vernünftig.
Weil man es so macht. Weil man so ist. Weil man sonst aneckt.
Und heute?
Heute funktionierst du nach außen.
Du nickst. Du leistest. Du benimmst dich.
Aber innerlich hast du dich längst zurückgezogen
von dir selbst.
Von dem, was einmal wild, laut und lebendig war.
Du lebst brav. Und brichst innerlich.
Hältst dich an Regeln, die nie die deinen waren.
Du wunderst dich, dass du traurig bist – oder leer.
Vielleicht nennst du es Erschöpfung.
Vielleicht nennst du es Alltag.
Aber vielleicht ist es einfach: Selbstverrat.
Du bist innerlich die Fortsetzung deiner plüschigen Erziehung.
Du lebst weiter, was dir beigebracht wurde:
Nicht zu viel sein. Nicht zu sichtbar. Nicht zu echt.
Lieber angepasst als auffällig. Lieber höflich als wahrhaftig.
Doch es reicht.
Befreie dich.
Nicht von deiner Vergangenheit –
sondern vom Gehorsam ihr gegenüber.
Hör auf, Erziehungsfolgen für Persönlichkeit zu halten.
Finde zurück zu dem, was du nie verloren hast – nur vergessen:
Deine Wildheit.
Deine Wahrheit.
Dein Recht, dich gut zu fühlen – ohne dich dafür zu schämen.
Also hör auf, Mauern hochzuziehen.
Hör auf, dich zu ducken, wenn du glänzt.
Hör auf, dein Licht zu dimmen, nur weil andere Schatten werfen.
Hol dir dein verdammtes Leben zurück. Heute. Nicht irgendwann.
Du bist kein Kind mehr.
Aber das Kind in dir –
es wartet schon viel zu lange darauf, dass du es endlich ernst nimmst.
Vielleicht ist heute der Tag, an dem du nicht weiter funktioniers.
Sondern beginnst, wieder du selbst zu sein.
Was wäre dein erster Schritt?
Wer bin ich, wenn ich werden kann?
Identität, Selbstverbesserung und den verdammten freien Willen.
Es gibt so Sätze, die ich so oft gehört habe, dass sie schon fast wie taubes Hintergrundrauschen im Lärm unserer Welt ihren Platz haben.
Erkenne dich selbst. Werde, der du bist.
Klingen gut. Klingen tief. Aber wenn man sie ernst nimmt, fängt es an zu knirschen.
Denn was soll das heißen, sich selbst erkennen? Was genau erkenne ich da? Gibt es in mir einen festen Kern, ein wahres Ich, das irgendwo unter Schichten aus Anpassung, Kindheit, Selbsttäuschung verborgen liegt?
Oder ist das Ich nicht viel eher ein bewegliches Ding? Eine Skizze, ein offenes Ende, das sich in jedem Moment verändert?
Wenn ich mich entwickeln kann und jeder Ratgeber, jedes Podcastzitat, jede Coachingbroschüre brüllt mir das ins Gesicht, dann muss sich dieses Selbst, was ich eigentlich finden will, ja verändern lassen.
Es ist nicht fix. Es ist formbar. Ein Stück nasser Seife gleich. Also kann ich nicht nur erkennen, was ich bin. Ich muss auch entscheiden, was ich sein will. Und genau da wird es schwierig.
Denn wie finde ich heraus, wer ich wirklich bin, wenn ich gleichzeitig ständig werde? Wenn alles fluide ist? Wenn mein Ich nicht ein rauer Stein, sondern ein Strom ist?
Vielleicht ist das der Punkt: das Ich als Fluss. Immer in Bewegung, immer neu, aber doch mit einer Richtung, mit einem Verlauf. Kein fester Kern, aber ein erkennbares Muster.
Aber selbst das ist schon fast wieder zu poetisch. Denn der Fluss fließt ja nicht einfach so. Er wird gespeist von Prägungen, Ängsten, Erlebnissen, Träumen, Zufällen.
Und dann kommt Schopenhauer und wirft die Bombe rein: Du kannst tun, was du willst aber du kannst nicht wollen, was du willst.
Und plötzlich ist alles noch brüchiger.
Denn wenn ich nicht wollen kann, was ich will, was bleibt dann von all dem Gerede über Selbstbestimmung, Selbstverbesserung, Selbstverwirklichung?
Bin ich dann nur ein Automat mit eingebauten Wünschen? Ein biologisch-soziales Uhrwerk, das meint, es handle frei, aber in Wahrheit nur ausführt, was ohnehin programmiert war?
Diese Frage lässt sich nicht wegoptimieren. Man kann sie überkleben mit Produktivität, mit Fitness, mit Karriere. Aber sie fault weiter im Fundament.
Vielleicht liegt die Antwort – wenn es überhaupt eine gibt – in der Selbstbeobachtung.
Nicht im Tun, sondern im Bemerken.
Ich will etwas. Okay. Aber will ich auch, dass ich es will? Oder ist da ein Teil von mir, der sagt: Das fühlt sich falsch an. Das ist nicht meins. Das habe ich irgendwo übernommen, aus Angst, aus Anpassung, aus Gewohnheit.
Genau hier beginnt so etwas wie Freiheit. Nicht in der Wahl zwischen Apfel und Schokolade. Sondern in der Frage, warum ich überhaupt Lust auf Zucker habe. Warum ich Leistung will. Warum ich gefallen will. Warum ich sein will wie jemand anderes.
Selbsterkenntnis ist kein Wellnessprogramm. Sie ist Sezieren. Sie ist Infragestellen. Sie ist zum Kotzen.
Und Selbstentwicklung – wenn sie ernst gemeint ist – ist kein Ziel mit Meilensteinen. Es ist ein dauerndes Werden. Ein permanenter Widerstand gegen Selbsttäuschung.
Kein glattes, glänzendes Ich, das sich auf LinkedIn präsentiert, sondern ein rissiges, ringendes Ich, das sich fragt: Wer spricht da gerade in mir? Und will ich, dass derjenige das Sagen hat?
Die größte Lüge der Selbstoptimierung ist, dass man irgendwo ankommt. Dass es ein fertiges Ich gibt, ein finales Upgrade.
Aber vielleicht ist genau das das Menschliche: dass wir niemals fertig sind. Dass unser Ich kein Zustand ist, sondern ein Vorgang. Kein Produkt, sondern eine offene Baustelle wie ein Dombau.
Und dass es Mut braucht, sich nicht zu optimieren, sondern sich zu befragen.
Und dann kommt wieder dieser Satz: Gehe deinen Weg.
Stark. Klar. Selbstbewusst. Aber auch hier: sofort die Reibung.
Was ist mein Weg? Woher weiß ich, dass er wirklich meiner ist?
Wenn ich mich ständig verändere, wenn meine Sicht sich wandelt, meine Haltung sich verformt, meine Motive sich auflösen – was bleibt dann vom Eigenen?
Und dann die nächste Frage: Kann ich überhaupt wollen, diesen Weg zu gehen? Oder geht er mich?
Vielleicht ist die Antwort gar nicht in der Richtung zu finden. Vielleicht ist es nicht der Weg, sondern das Gehen selbst.
Nicht mein Weg, sondern ein Weg.
Nicht Ziel, nicht Ankommen, sondern Bewegung.
Denn Bewegung ist Leben.
Was sich nicht bewegt, stirbt.
Was sich nicht wandelt, bricht.
Was sich selbst für gefunden hält, hört auf, zu suchen und verliert sich genau dadurch.
Also vielleicht ist das die einzig tragbare Sichtweise – nicht als Antwort, sondern als Haltung:
Bleibe in Bewegung.
Erkenne dich – aber rechne damit, dass du dich wieder verlierst.
Werde, wer du bist – aber sei bereit, dich neu zu entwerfen.
Gehe deinen Weg – aber sei wachsam, ob er noch dein eigener ist.
Und dann: Ich geh weiter. Nicht weil ich weiß, wohin. Sondern weil das Gehen selbst mein Ausdruck ist.